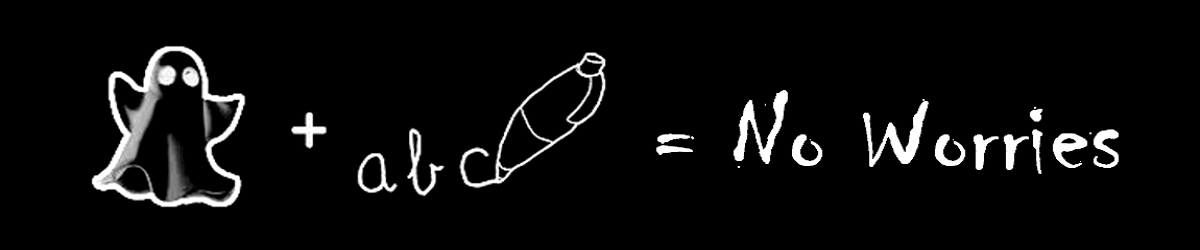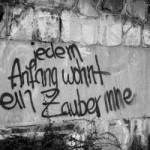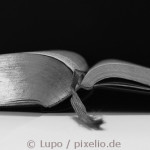Jede wissenschaftliche Arbeit folgt einem festen Aufbau aus Einleitung, Haupt- und Schlussteil. Bei Seminar- und Hausarbeiten beschränkt sich die Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit auf wenige (Unter-)Kapitel, mit steigendem Umfang erhöht sich auch die Komplexität der Struktur. Dabei sollte das Verhältnis von Kapiteln und Länge der Arbeit stimmen.

Struktur der Arbeit
Hinzu kommen die üblichen Verzeichnisse, sodass die Arbeit letztlich wie folgt aufgebaut ist:
- Titelblatt
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- evtl. Zusammenfassung (Abstract)
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Fazit / Schluss
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Eidesstattliche Versicherung
Die Position der Verzeichnisse kann dabei variieren und wird in der Regel durch die formalen Vorgaben der Hochschule bestimmt.

Titelblatt
Das Titelblatt ist gleichzeitig das Deckblatt der Arbeit. Die Angaben, die hier zu tätigen sind, werden durch das Prüfungsamt vorgegeben. Neben dem Namen der Hochschule und dem Fachbereich sind dies in der Regel der Titel der Arbeit und Angaben zum Studierenden (Name, Matrikelnummer, Semesterzahl, Kontaktadresse).
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Alle Abbildungen und Tabellen, die in der Arbeit verwendet werden, müssen hier in einer Übersicht genannt werden, wobei Abbildungen und Tabellen in getrennten Verzeichnissen aufgeführt sind. Neben der fortlaufenden Nummerierung (Abb. 1, Abb. 2 usw.) steht hier der Titel der Abbildung sowie die Seitenzahl. In einem Programm wie Word ist es möglich, das Verzeichnis automatisch zu erstellen, wenn die Abbildungen im Fließtext entsprechend beschriftet sind.

Abkürzungsverzeichnis
In das Abkürzungsverzeichnis gehören alle verwendeten Abkürzungen, die über allgemein bekannte Kürzel hinaus gehen. Es ist nicht erforderlich, „d. h.“ oder „z. B.“ in das Abkürzungsverzeichnis aufzunehmen, weniger geläufige Abkürzungen wie UNHCR jedoch schon. Zu beachten ist, dass jede im Text benutzte Abkürzung bei ihrer ersten Nennung ausgeschrieben wird (z. B.: „… das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR)…“, bevor im weiteren Verlauf das Kürzel ausreicht.
evtl. Zusammenfassung (Abstract)
Vor allem bei Masterarbeiten und Arbeiten im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich sind kurze Zusammenfassungen üblich, welche die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit darstellen. Diese ist in der Regel zwischen einer halben und einer Seite lang.

Inhaltsverzeichnis
Das Inhaltsverzeichnis gibt die Struktur der Arbeit wieder. Wichtig: Die Überschriften des Textes müssen mit den Nennungen im Inhaltsverzeichnis übereinstimmen. Gleiches gilt für die Nummerierung: Sind Kapitel in der Arbeit mit 1. – 1.1. – 1.1.1. – usw. gegliedert, erscheint dies auch im Inhaltsverzeichnis. In der Regel werden hier die ersten drei Ebenen aufgeführt, wohingegen in der Arbeit je nach ihrem Umfang auch eine vierte genutzt werden kann.
Die Gliederung sieht in der Regel wie folgt aus:
1. Gliederungspunkt (1. Ebene)
1.1. Gliederungspunkt (2. Ebene)
1.2. Gliederungspunkt (2. Ebene)
1.2.1. Gliederungspunkt (3. Ebene)
1.2.2. Gliederungspunkt (3. Ebene)
1.3. Gliederungspunkt (2. Ebene)
2. Gliederungspunkt (1. Ebene)
Jede Untergliederung sollte aus mindestens zwei Punkten bestehen. In einem Programm wie Word ist es möglich, das Verzeichnis automatisch zu erstellen, wenn die Überschriften im Fließtext entsprechend beschriftet sind.
Eine Gliederung, die bereits vor dem Verfassen der Arbeit in groben Zügen steht, vereinfacht den Schreibprozess ungemein!

Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema ein und rahmt die Arbeit gemeinsam mit dem abschließenden Fazit. Ihr Umfang beträgt bei Seminararbeiten etwa eine Seite, bei Bachelorarbeiten mit einem Umfang von 40-60 Seiten etwa zwei Seiten. Neben einer allgemeinen Heranführung des Lesers an das Thema erfolgt hier die Benennung der Forschungsfrage, eine Kontextualisierung in den aktuellen Forschungsstand sowie eine Darstellung der geplanten Methode, mit der das Thema bearbeitet wird.
- thematische Hinführung zum Thema
- Benennung des Thema und Forschungsfragen
- methodisches Vorgehen
- Zielsetzung der Arbeit
- ggf. Erläuterungen zum Aufbau der Arbeit
Bei mehrseitigen Einleitungen ist es sinnvoll, diese Punkte als eigene Unterpunkte zu erstellen (Gliederung der 2. Ebene).
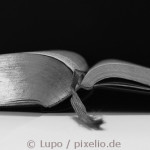
Hauptteil
Der Hauptteil gliedert sich je nach Umfang der Arbeit in weitere Unterpunkte. Bei umfangreichen Arbeiten geht der eigentlichen Beantwortung der Forschungsfrage ein theoretischer Teil voran, welcher das Thema in den wissenschaftlichen Kontext einordnet und grundlegende Definitionen bietet. Gleichzeitig führt der Theorieteil Kriterien für die Eigenanalyse ein und verdeutlicht den aktuellen Forschungsstand. Wichtig ist dabei vor allem das richtige Zitieren, um den wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen und vor Plagiaten sicher zu sein.
In einem zweiten Schritt folgt der Eigenanteil der Arbeit, was z. B. eine Fallstudie, eine quantitative Datenerhebung oder die Auseinandersetzung mit vorhandener Forschungsliteratur sein kann. Dieser Teil endet mit einer Ergebnisdarstellung und/oder Diskussion unter Bezugnahme auf den theoretischen Teil. Insgesamt sollte der Eigenanteil der Arbeit 30-50% des Gesamtumfangs betragen.

Fazit / Schluss
Das Fazit ist von ihrem Umfang her ähnlich wie die Einleitung. Hier werden Ergebnisse kurz zusammen gefasst, eventuelle Probleme bei der Bearbeitung benannt und Hinweise auf den weiteren Forschungsbedarf gegeben.
Literaturverzeichnis
Jegliche Literatur, die in der Arbeit als Quellenangabe im Text benannt ist (und nur diese!) wird im Literaturverzeichnis aufgeführt. Nicht genannt werden Werke, die der Verfasser gelesen hat, aber auf die er sich nicht explizit bezieht. Die Darstellung erfolgt alphabetisch nach der Zitation der Vorgabe der Hochschule. Hier gibt es verschiedene Stile, wobei sich immer häufiger APA- und Harvard-Style durchsetzen.

Anhang
Abbildungen und Tabellen, die für das Textverständnis wichtig sind, sind bereits im Fließtext der Arbeit enthalten. Weiterführende Abbildungen, der Arbeit zugrunde liegende Fragebögen oder zusätzliche Informationen sind hingegen Bestandteil des Anhangs, auf den im Text an entsprechender Stelle verwiesen wird.
Eidesstattliche Versicherung
Am Ende der Arbeit steht immer häufiger die Eidesstattliche Versicherung des Verfassers. Diese besagt, dass die Arbeit ohne Zuhilfenahme nicht benannter Quellen und fremde Hilfe erfolgt ist.

Formalia bei wissenschaftlichen Arbeiten
Wichtig ist die Berücksichtigung der formalen Kriterien, welche die Hochschule vorgibt. Die Angaben zu Schriften, Zeilenabständen und Seitenrändern sind meist in einem Leitfaden festgehalten, den die Hochschule in Einführungsseminaren verteilt oder auf der Webseite des Institutes zum Download zur Verfügung stellt. Wir bieten eine Formatvorlage wissenschaftliche Arbeit an, die Sie entsprechend Ihrer Vorgaben nur noch anpassen müssen.
Wichtig ist außerdem die Einhaltung der Rechtschreibung, da diese teilweise zu 30% zur Endnote beiträgt. Einige Hochschulen benennen als Mindestkriterium „die Taste F7 in Word“, d. h. die automatische Rechtschreibkorrektur, nicht schaden kann aber auch ein professionelles Lektorat – gerade, wenn es um die Abschlussarbeit geht.
Der Schreibstil sollte wissenschaftlichen Kriterien genügen, d. h.
- klar und präzise sein und auf Umgangssprache verzichten
- in angemessenem Umfang Fachbegriffe und Fremdwörter beinhalten
- einen verständlichen, nicht unnötig komplexen Satzbau haben

Hilfe bei der Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit
Gerne sind wir Ihnen im Rahmen unseres wissenschaftlichen Coachings bei der Strukturierung Ihrer Arbeit behilflich und arbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Gliederung aus, an der Sie sich bei der Erstellung der Arbeit orientieren können.